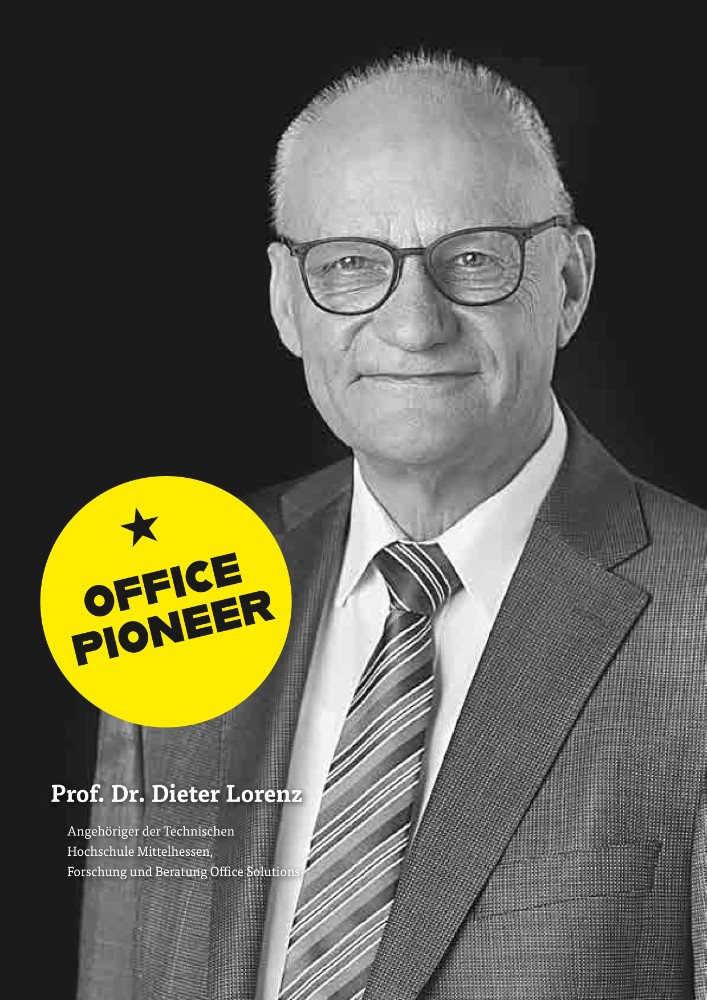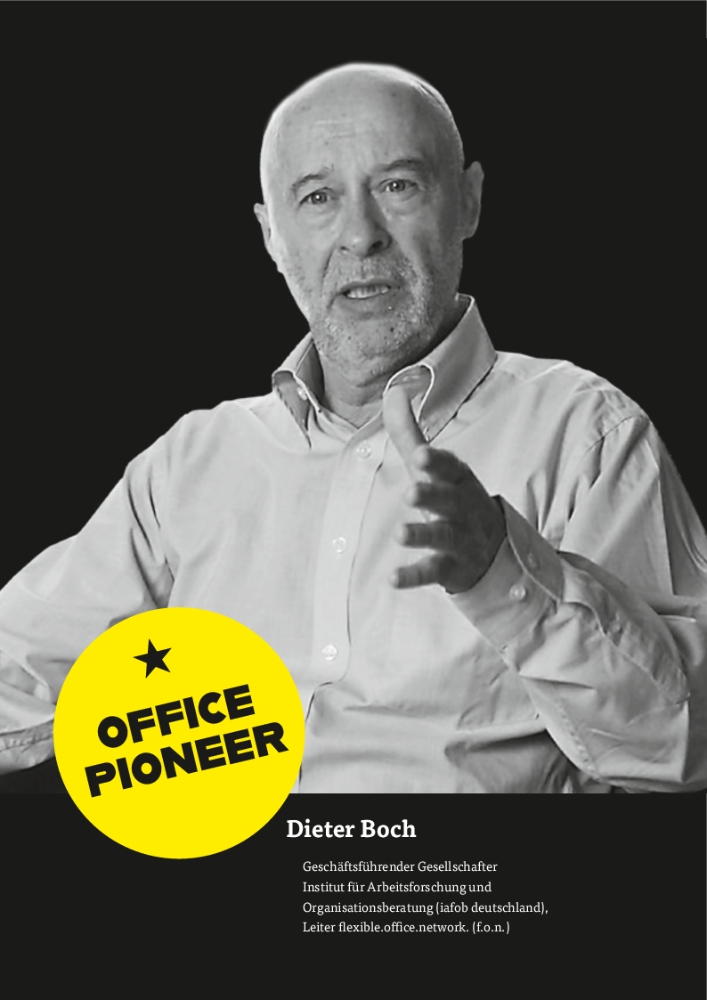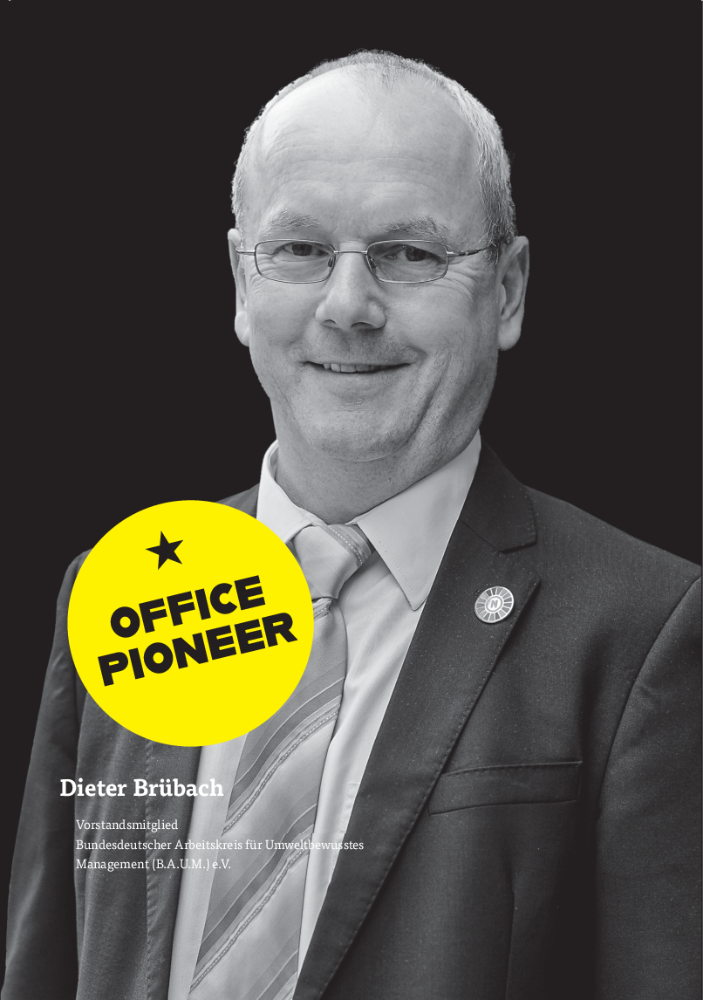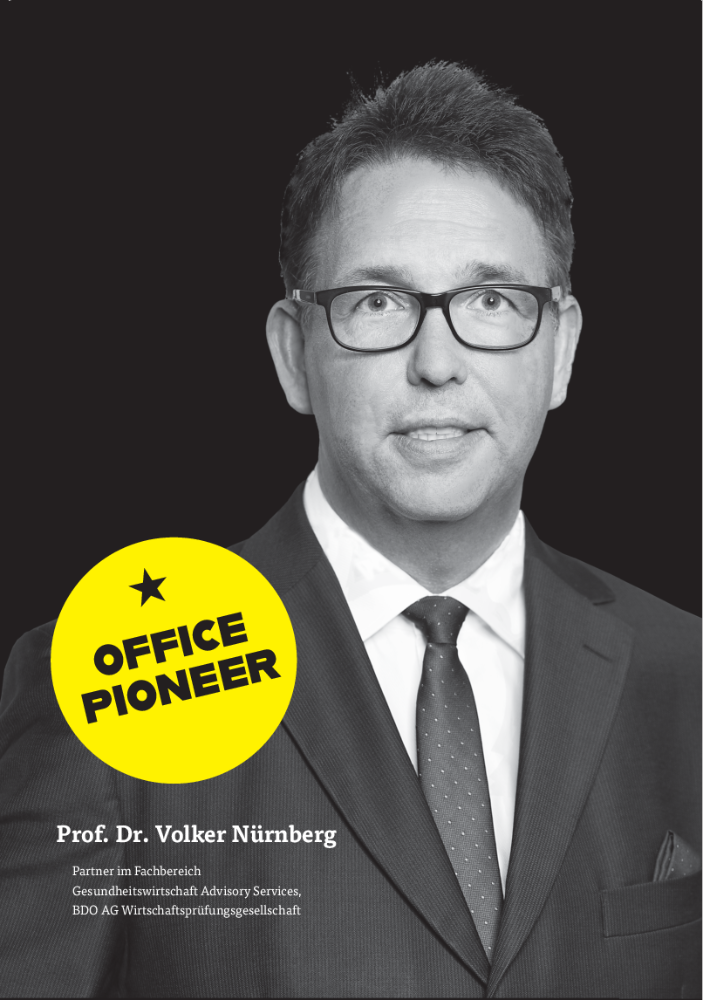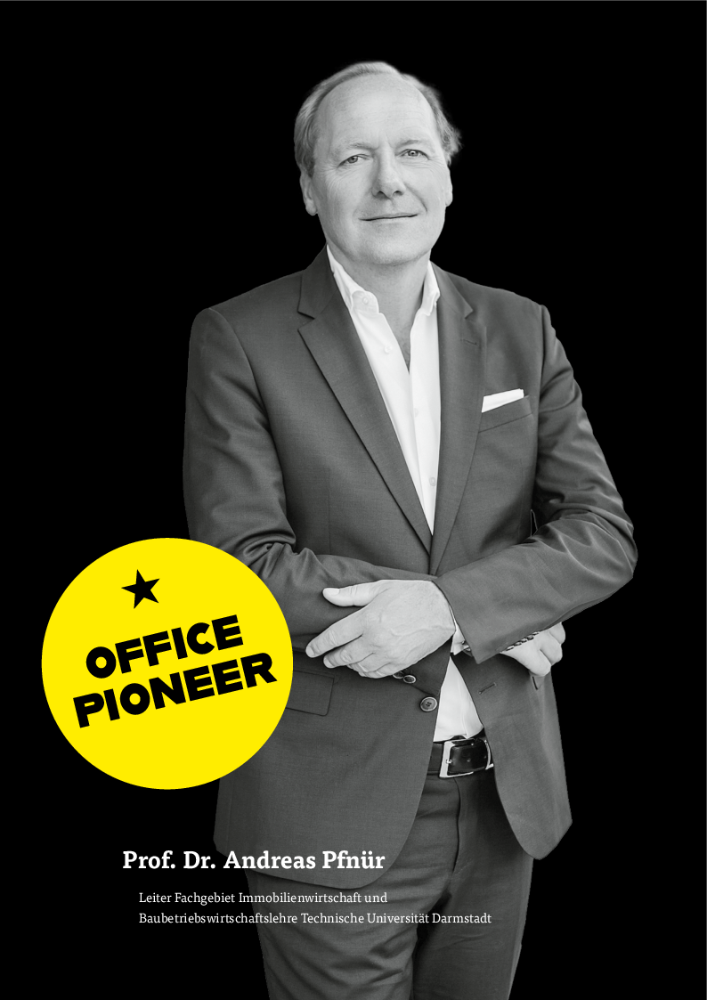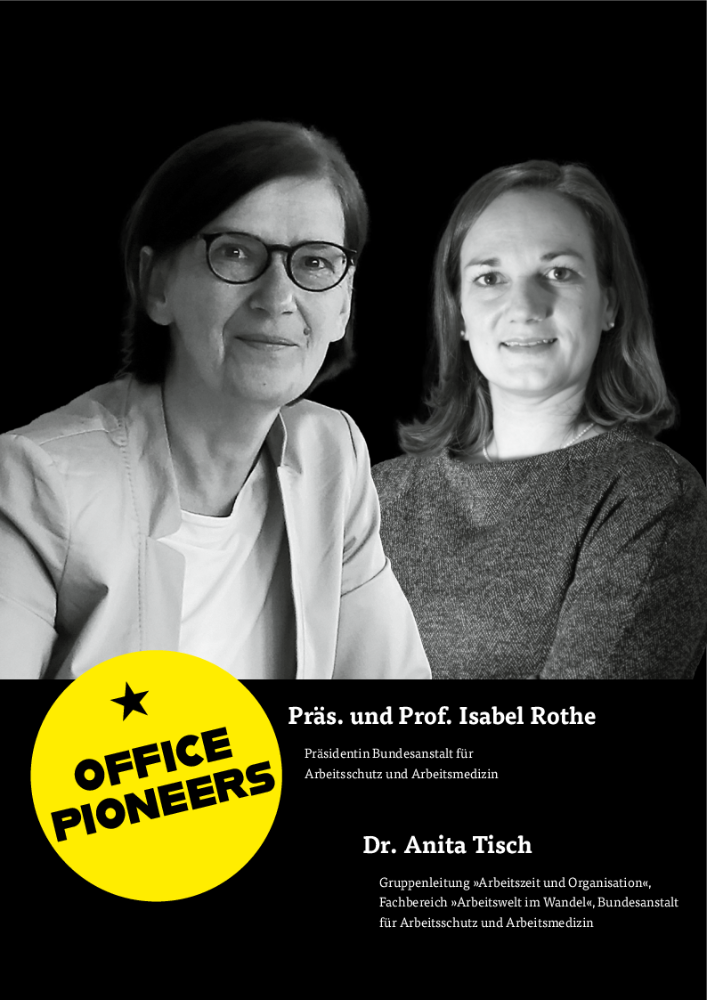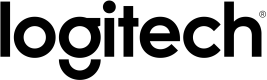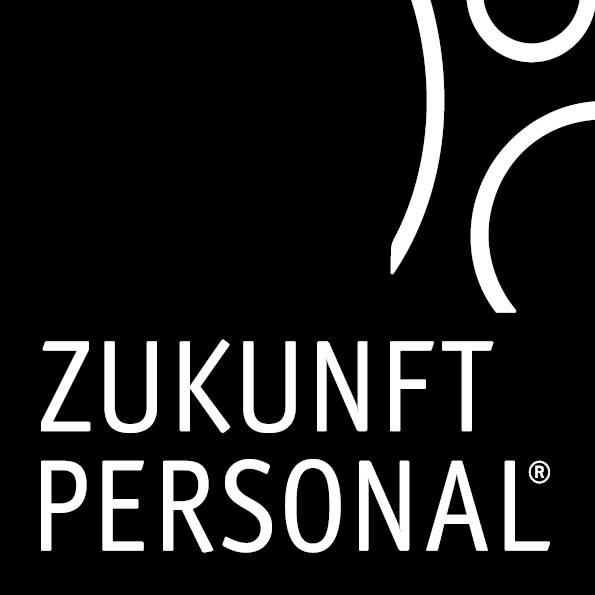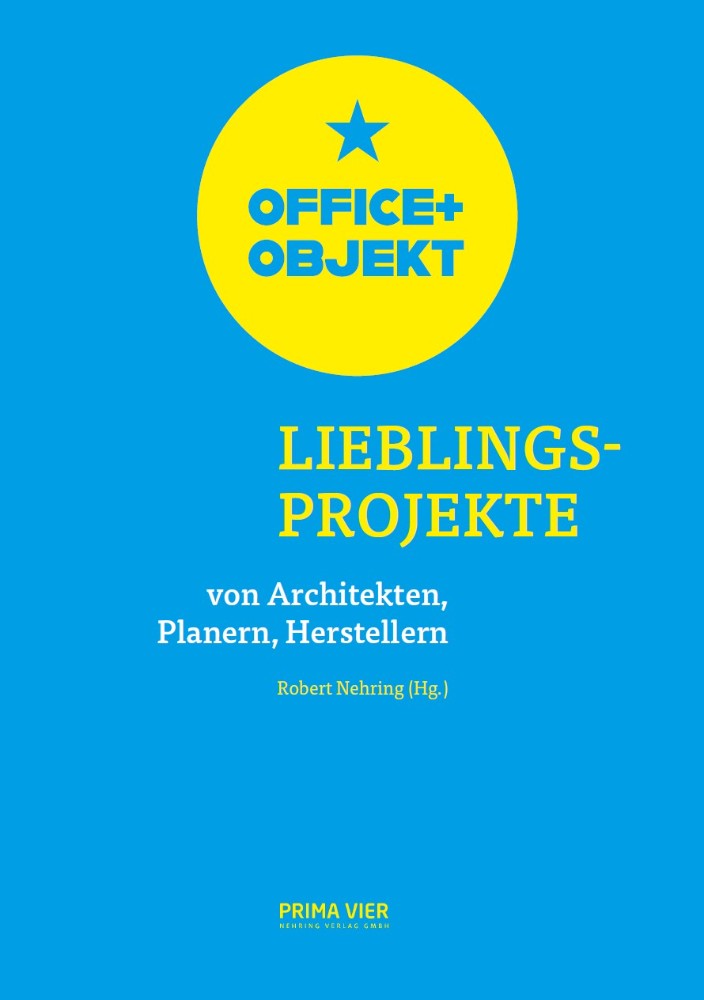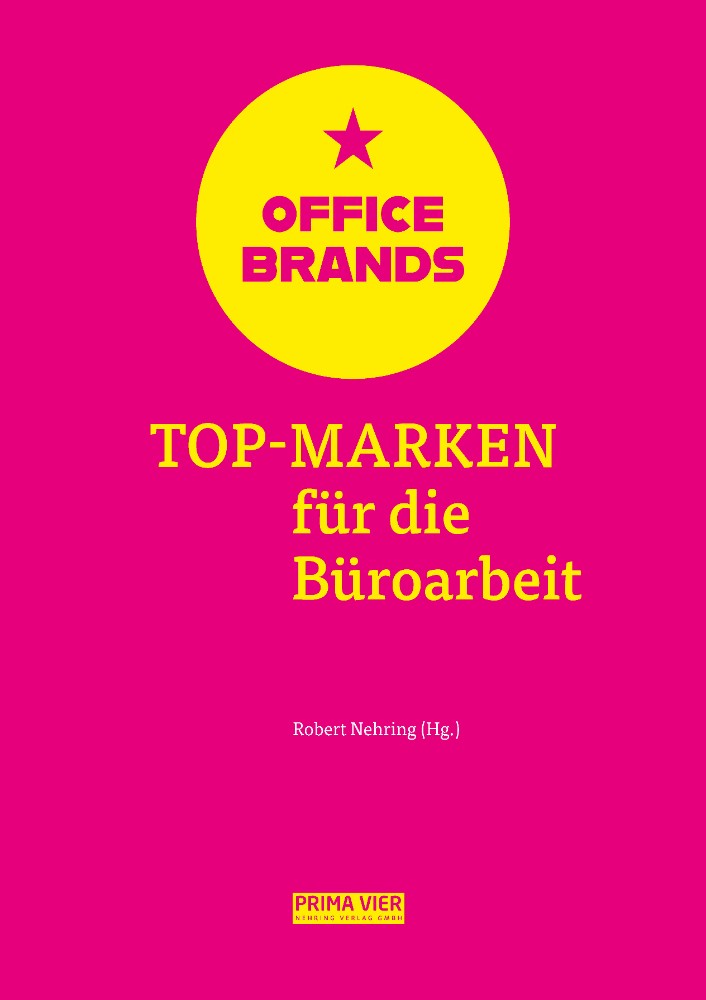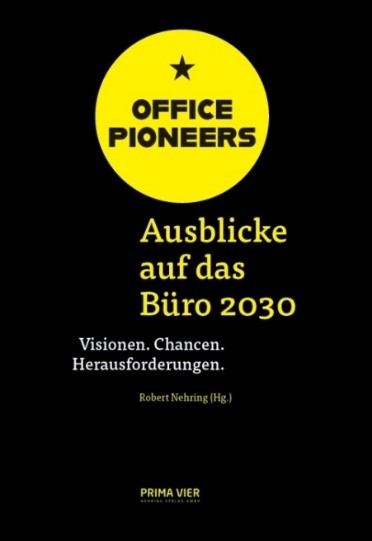Robert Nehring hat nicht viel von Marcel Proust gelesen, stellt aber ebenfalls gern viele Fragen. Interessanten Persönlichkeiten aus dem Büroumfeld schickt er auch mal einen Fragebogen. Diesmal antwortete Professor Dieter Lorenz, Emeritus der TH Mittelhessen und renommierter Arbeitsplatzexperte.
ARBEITEN
1. Bitte beschreiben Sie Ihren Arbeitsplatz.
Ich habe ein eigenes Büro bei mir zu Hause (circa 14 m2) und arbeite an einer Bench, die nach meinen Angaben von der Schreinerei Schnurr in Merdingen von Wand zu Wand eingebaut wurde. Bei seitlichem Lichteinfall arbeite ich wandorientiert. Die Docking-Station für mein Notebook (Fujitsu Life Book) ist in der dritten Ebene untergebracht. Mein Bildschirm (Fujitsu) steht in korrektem Sehabstand und richtiger Höhe. Ich sitze auf einem Bürodrehstuhl (Sedus). Ergänzt wird die Ausstattung durch ein HP-Multifunktionsgerät. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, an einem Stehtisch zu arbeiten.
2. In welcher Form sind Sie der Bürobranche heute verbunden?
Ich berate Unternehmen bei der Einführung neuer Büroformen (New Work) und führe ein mehrjähriges Projekt zur Akzeptanz non-territorialen Büroformen (Multispace) bei Nutzern mit langjährigen Einzelbüro-Erfahrungen durch. Seit mehreren Jahren nehme ich die Prüfungen für Quality Office Consultants ab, bin Ehrenmitglied im Deutschen Netzwerk Büro sowie Ehrenmitglied der DNA-Akademie. Hier arbeite ich mit unterschiedlichen Experten rund um das Thema Büro zusammen. Wir entwickeln neue, nachhaltige, nutzerorientierte Büroformen.
3. 1994 haben Sie die Arbeit „Lean-Office: die ganzheitliche Optimierung des Büros“ veröffentlicht. Worum ging es da?
Ein wesentlicher Bestandteil meines Lean-Office-Konzeptes war und ist die Planung und Gestaltung reversibler Büros, also ein Bürohaus so zu planen, dass alle gängigen Büroformen (Einzel-, Kombi-, Gruppen-, Großraum-Büro und Multispace) darin problemlos umgesetzt werden können. Dieser damals neue Ansatz hat sich zwischenzeitlich zu einem Standard entwickelt. Neben dem reversiblen Büro gehört dazu ebenso eine partizipative Büroplanung und deren leicht an die Bedürfnisse der jeweiligen Abteilung und Nutzer anpassbare Bürogestaltung.
Übrigens: Als ich damals ankündigte, die Weiterentwicklung des Lean-Office müsse auch eine Nutzung der Büroimmobilie als Wohnraum mit einfachen Mitteln zulassen, wurde ich belächelt. Das sei doch völlig unwirtschaftlich und niemand bräuchte eine solche Immobilie. Ich denke, heute wäre man froh über solche Büroimmobilien, die auch nach ihrer Nutzung als Bürohaus mit einfachen Anpassungsmaßnahmen in eine Wohnimmobilie umgebaut werden könnten.
4. Wie anschlussfähig finden Sie Ihre Gedanken von damals darüber hinaus?
Gerade berate ich ein Unternehmen, das meinen Lean-Office-Ansatz vor 25 Jahren abgelehnt hat mit dem Argument, ein reversibles Büro benötige höhere Raumhöhen als ein Zellenbüro und damit könnte der Neubau nur sechs Stockwerke aufweisen. Das Zellenbüro konnte jedoch mit sieben Stockwerken gebaut werden, um unter der Hochhausgrenze zu bleiben; sei also deutlich wirtschaftlicher. Genau dieses Gebäude bereitet dem Unternehmen jetzt größte Probleme bei der Umstellung auf einen non-territorialen Multispace. Wer weiß schon, welche Büroform in zehn Jahren benötigt wird? Hier ist Flexibilität auch im Sinne von Nachhaltigkeit geboten. Multifunktionale Immobilien sind nachhaltig. Ich stelle mir eine Immobilie vor, die unter der Woche oder an drei Tagen ein Bürohaus darstellt, aber auch Übernachtungsmöglichkeiten für Mitarbeitende bietet, die weit entfernt in ihrem Homeoffice arbeiten und nur an wenigen Tagen am Standort des Unternehmens arbeiten. Auch eine weitere Nutzung, etwa für kulturelle Angebote, kann ich mir vorstellen.
Zusammen mit den Experten der DNA-Akademie entwickeln wir das Konzept gerade weiter. Dabei geht es um höhere Nutzungsintensitäten und weniger Leerstand. Die DNA-Akademie wird hierzu demnächst eine Veröffentlichung vorstellen.
5. Der coronabedingte Umstieg auf Homeoffice klappte anfangs besser, als viele dachten. Manche fordern seitdem ein Recht auf Homeoffice. Wie stehen Sie zu dieser Entwicklung?
Die Tätigkeiten im Büro sind zu unterschiedlich, dass ein generelles Recht auf Homeoffice sinnvoll wäre. Auch wenn mir bewusst ist, dass das Arbeiten im Homeoffice ein fester Bestandteil der künftigen Arbeitswelt sein wird, plädiere ich aus mehreren Gründen dafür, dass die Mitarbeitenden eines Unternehmens mindestens an zwei, drei Tagen pro Woche im Büro sein sollten. Vorzugsweise entstehen Innovationen im direkten Austausch mit Kollegen und/oder es können Probleme und Störungen in den Arbeitsprozessen rasch gelöst werden. Das soziale Miteinander im Büro gibt die Chance, Beschäftigte eher an ein Unternehmen zu binden, als die räumliche Distanz im Dauer-Homeoffice. Vereinsamung von Singles sowie Stress im Homeoffice bilden ein weiteres Problem. Als Arbeitswissenschaftler sehe ich die größte Herausforderung darin, für gute Arbeitsbedingungen im Homeoffice zu sorgen. Während wir zwischenzeitlich in den meisten Unternehmen sehr gute Ausstattungen an Sitz-Steh-Arbeitsplätzen mit ergonomischen Bürodrehstühlen, richtiger Anordnung von Arbeitstisch und Bildschirm, also gute ergonomische Bedingungen vorfinden, ist das zu Hause eher der Ausnahmefall. Arbeiten am Küchen- oder Wohnzimmertisch mit nicht einstellbaren Stühlen ausschließlich am Laptop ggf. mit Direkt- und Reflexblendungen dürfen nicht sein. Leider scheuen sich viele Unternehmen davor, die gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsanalyse im Homeoffice durchzuführen. Und die Selbstverantwortung der Mitarbeitenden ist trotz vielfältiger Informationsmöglichkeiten zu ergonomisch guten Arbeitsbedingungen oft noch nicht genug ausgeprägt.
OFFICE ROXX plus
Dieser Beitrag ist kostenpflichtig. Wenn Sie bereits Kunde sind, können Sie sich hier einloggen.
OR+ Abonnement
Erhalten Sie dauerhaft Zugriff auf alleOR+ Beiträge und das komplette
Heftarchiv.