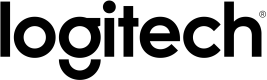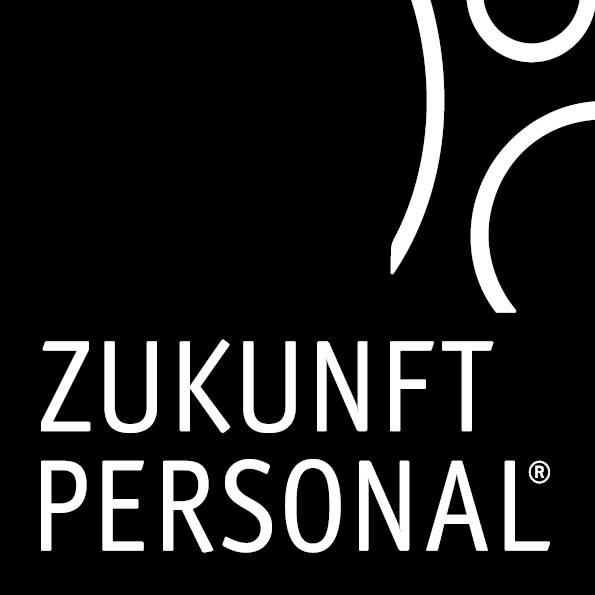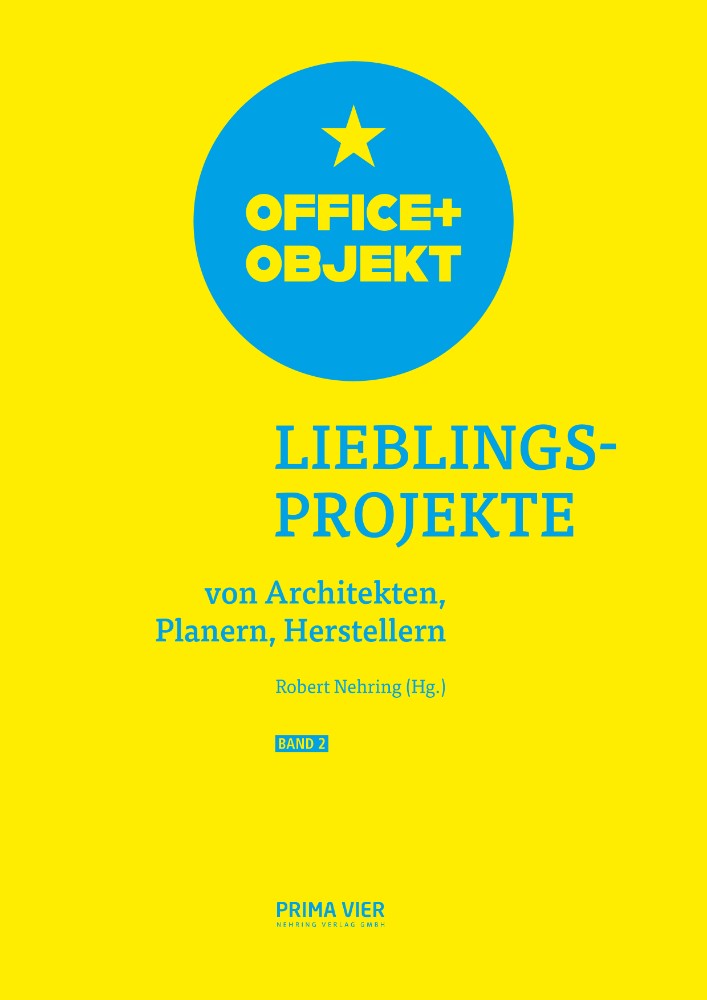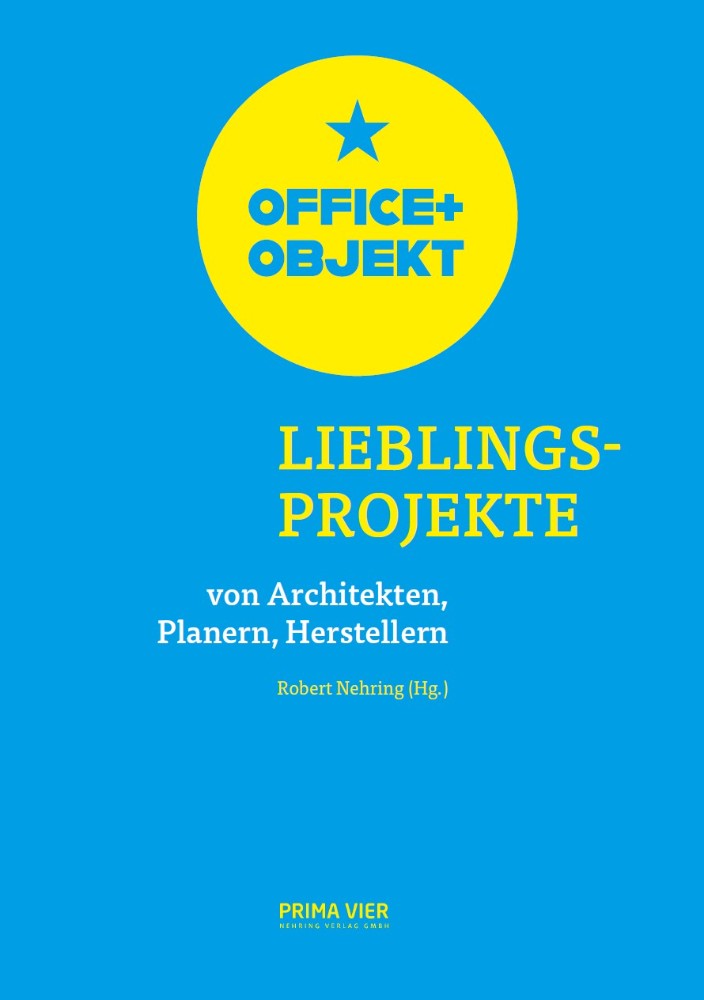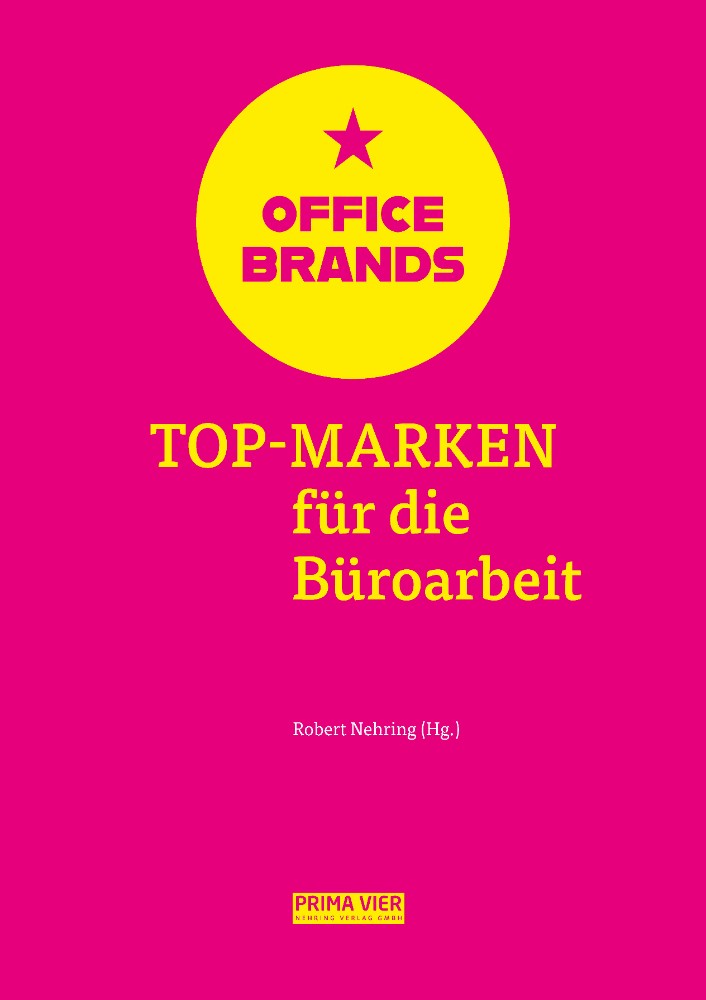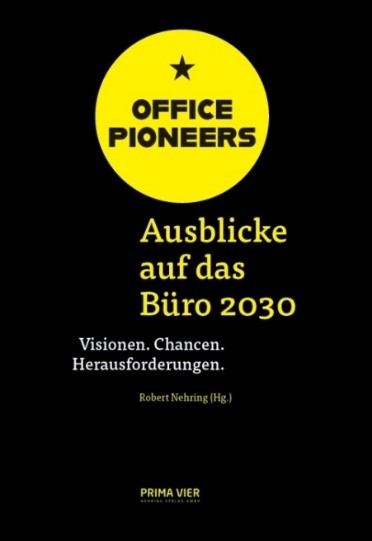Die Innenarchitektur moderner Büros ist vielfältig und vor allem wohnlicher geworden. Das erfordert ein Umdenken bei den Lichtkonzepten. Nicole Kober und Kay Pawlik, Geschäftsführende Gesellschafter von Kober Lichtplaner, erläutern Grundlagen für Corporate Office und Homeoffice.

New-Work-Lichtplanung für das Logistikunternehmen Fiege im Gebäudekomplex X-Dock im Stadthafen Münster. Abbildung: Kober Lichtplaner
In der Lichtplanung hat sich seit einigen Jahren der Ansatz des Human Centric Lighting (HCL) etabliert. Er berücksichtiget moderne technische Aspekte wie Sensorik, Einstellbarkeit der Lichtfarbtemperatur oder Lichtsteuerung und bezieht die menschliche biologische und psychologische Wahrnehmung ein – ein ganzheitlich gedachter Ansatz für zeitgemäßes Licht in Arbeitswelten, gültig für Corporate Offices und Homeoffices. Hinzukommt, dass es bei der Beleuchtung von Büros heute im Wesentlichen nicht mehr um den persönlichen Arbeitsplatz geht, sondern um Arbeitsplätze, die über den Tag verteilt unterschiedlich genutzt werden: Stillarbeit am PC, Teambesprechungen im Stehen oder auf einer Sofalandschaft, Videokonferenzboxen oder flexible Projektbereiche. Das erfordert eine Anpassung der Lichtkonzepte.
Natürliche Inspiration
Licht, wie es in der Natur vorkommt, sollte die Grundlage einer auf den Menschen ausgerichteten Lichtplanung sein – im Büro wie im Restaurant. Denn das natürliche Licht hat über Jahrtausende sowohl unsere Wahrnehmungsbiologie, als auch die Wahrnehmungspsychologie geprägt. So sind beispielweise unsere Lichtrezeptoren in den Augen aufgrund der vorherrschenden Sonnenlichtrichtung von oben deutlich besser in der Wahrnehmung von Helligkeit auf Wänden als auf dem Boden. Eine wahrnehmungsorientierte Lichtplanung setzt daher stärker auf die gleichmäßige Beleuchtung von Wänden – die sogenannte Wandflutung – zur energieeffizienten und blendfreien Grundbeleuchtung von Raumtiefen und weniger auf die Beleuchtung von Böden. Denn dort wird das Licht trotz gleicher Lichtstärke weniger hell wahrgenommen. Auch die Tageslichtveränderung in der Natur über den Tagesverlauf hat unsere Wahrnehmung konditioniert: Wir verbinden rötliches, warmes Licht mit niedrigen Farbtemperaturen wie beim Sonnenaufgang bzw. -untergang und kühle Farbtemperaturen mit dem gleißenden Licht zur Mittagszeit.

Die Innenarchitektur moderner Büros wird immer wohnlicher, ein gutes Beispiel: der Olympus Campus. Das erfordert ein Umdenken bei den Lichtkonzepten. Abbildung: Christian Kretschmar
New Work Lighting
In den letzten Jahren haben sich die – eher funktionale – Beleuchtung von Corporate Offices und die – eher atmosphärische – Beleuchtung von Homeoffices stark gegenseitig beeinflusst. Unter dem Begriff New Work Lighting entstand ein neuer Ansatz: In der Vergangenheit war kaum ein Arbeitsplatz zu Hause so ergonomisch beleuchtet, dass dort acht oder mehr Stunden am Tag ermüdungsfrei gearbeitet werden konnte. Auf der anderen Seite hat die atmosphärische Beleuchtung der Homeoffices Einzug in die Lichtkonzepte moderner Büroumgebungen gehalten. Unter dem Begriff New Work Lighting entstand ein neuer Ansatz: Viele New-Work-Lichtkonzepte sind heute eine Mischung aus funktionalem und atmosphärischem Licht.
Praktische Grundlagen
Ob Corporate Office oder Homeoffice: Einige lichtplanerische und lichttechnische Grundlagen gelten für beide Arbeitswelten:
#1 Die Beleuchtung sollte stufenlos von mindestens 20 bis 100 Prozent dimmbar sein, sodass 300–750 Lux Beleuchtungsstärke erreicht und individuell eingestellt werden können.
#2 Leuchten mit variabler Farbtemperatur von 3.000 bis 5.000 K ermöglichen eine Arbeitsplatzbeleuchtung im Einklang mit dem Tageslichtverlauf und dem zirkadianen Zyklus.
#3 Die eingesetzten LED-Leuchten sollten eine Energieeffizienz von mindestens 100 Lumen pro Watt haben und idealerweise eine Farbwiedergabe von mindestens CRI90+.
#4 Blendungen durch schlecht oder falsch positionierte Leuchten sind zu vermeiden.
#5 Aufgeklappte, leicht schräg stehende Notebookmonitore sind deutlich anfälliger für Reflexionen als senkrecht stehende Bildschirme.
#6 Arbeitsplatzbeleuchtung muss videokonferenztauglich sein, heißt: ausreichende vertikale Beleuchtungsstärken zur Vermeidung starke Schattenbildung im Gesicht sowie flickerfreie Dimmtechnik, um laufende Streifen im Videobild zu vermeiden.
#7 Die Anpassungsfähigkeit der Beleuchtung an sich ändernde Nutzungsbedürfnisse ist essenziell, etwa durch intelligente, kabellose Lichtsteuerungssysteme sowie durch die Ortsveränderlichkeit der Leuchten.
#8 Trotz des Einsatzes von Sensorik und zentral gesteuerter lichttechnischer Automatisierung sollten Nutzer immer die Möglichkeit haben, die Helligkeit und Farbtemperatur im Nahfeld den eigenen Bedürfnissen anzupassen.
#9 Neben der Kunstlichtplanung gehört die Tageslichtplanung zu einem ganzheitlichen Lichtkonzept, zum Beispiel zur Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung auf Monitore.
Die Beleuchtung im Office – ob Corporate oder Home – ist dann gelungen, wenn künstliches Licht kaum wahrnehmbar ist. Gleichzeitig stellt sie, wie selbstverständlich dem Biorhythmus folgend, die richtige Lichtqualität und Lichtmenge bereit, um die vielfältigen Sehaufgaben im Laufe eines Arbeitstages ermüdungsfrei zu erfüllen.
 Abbildung: Kober Lichtplaner Nicole Kober & Kay Pawlik Geschäftsführende Gesellschafter, |