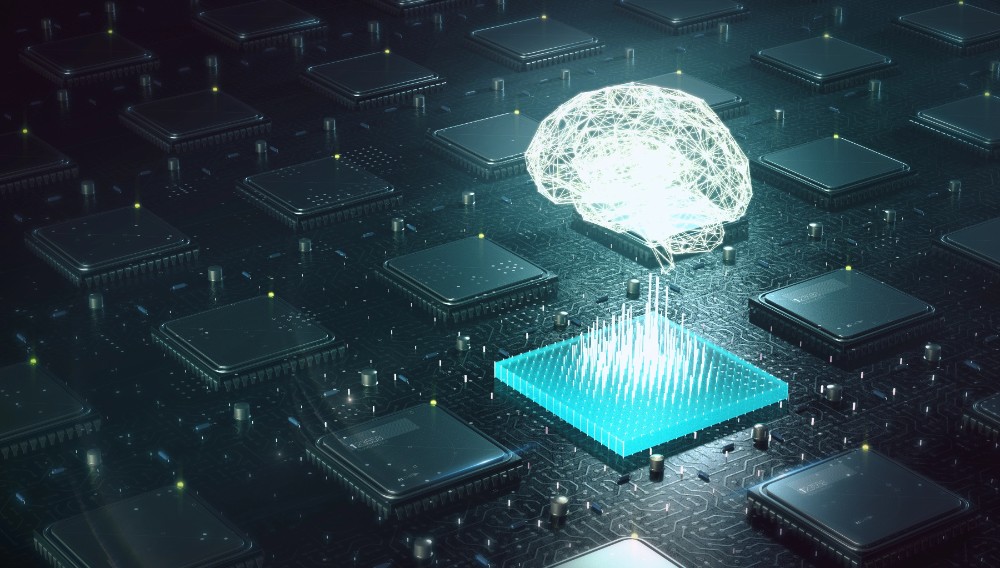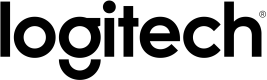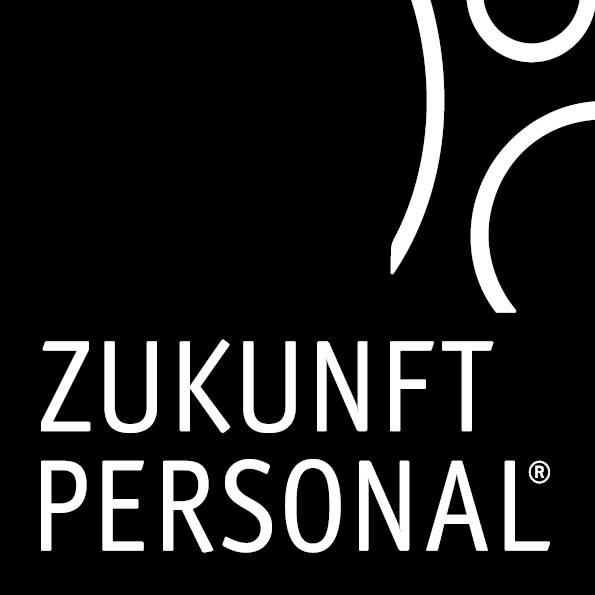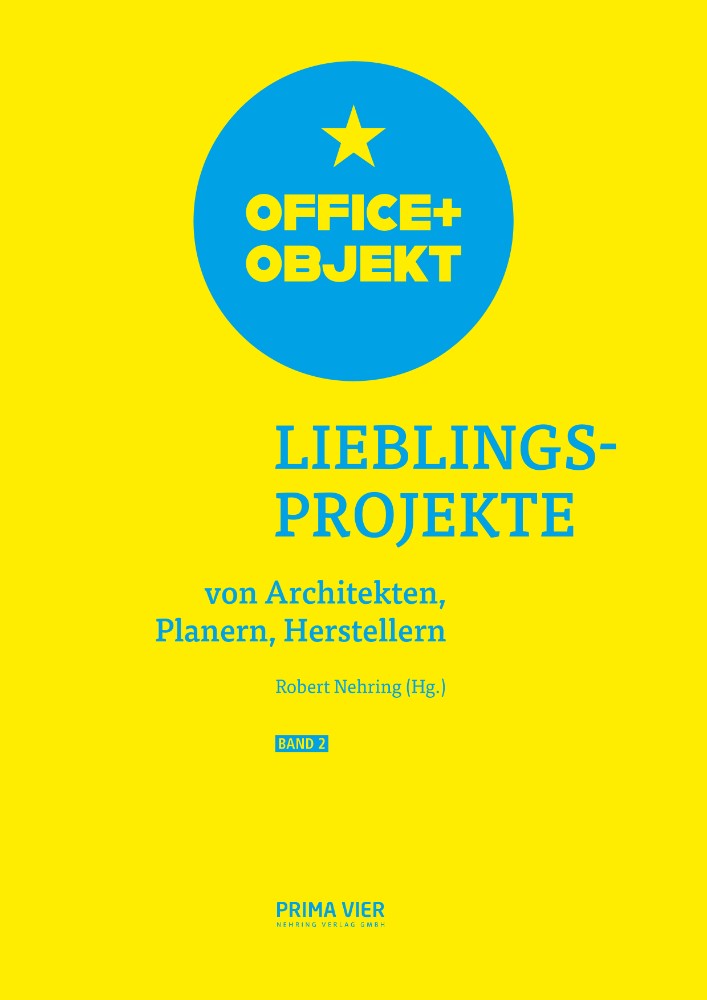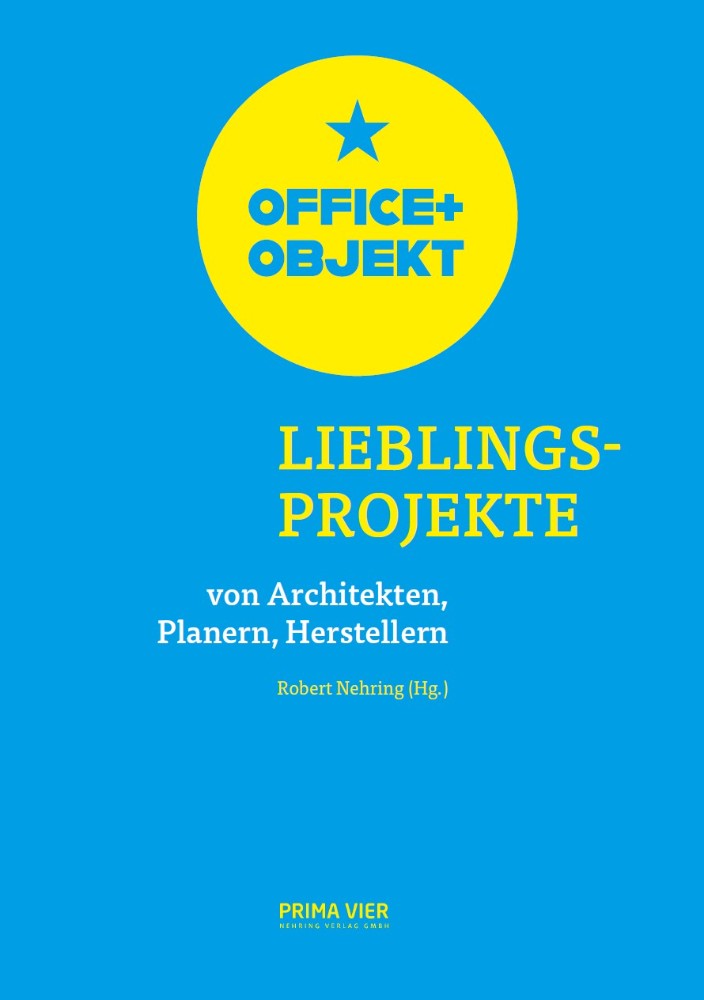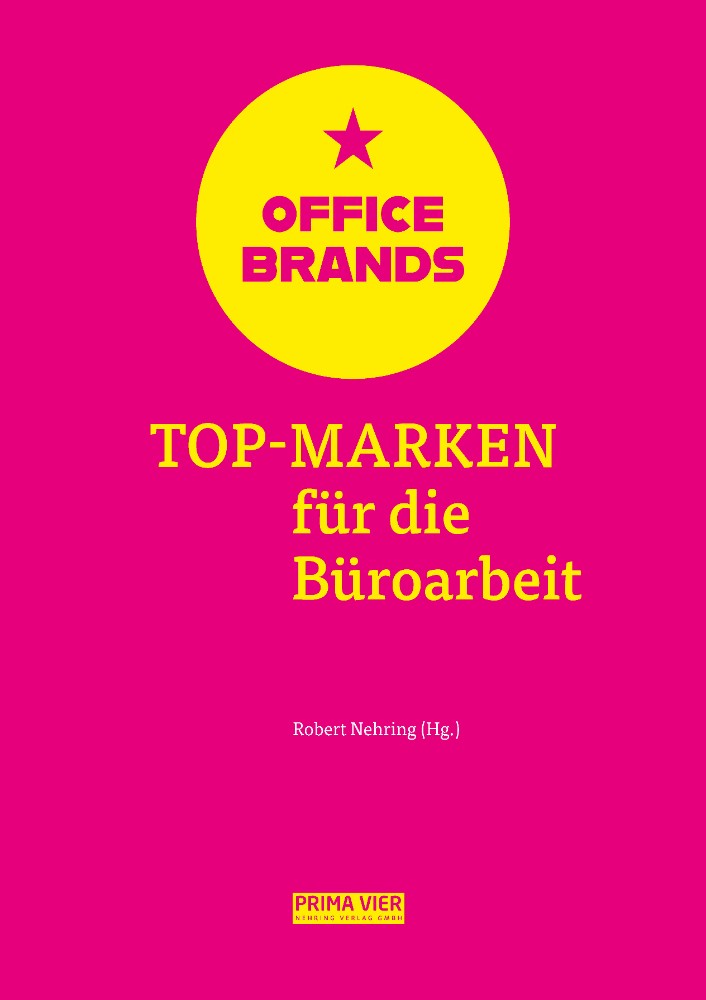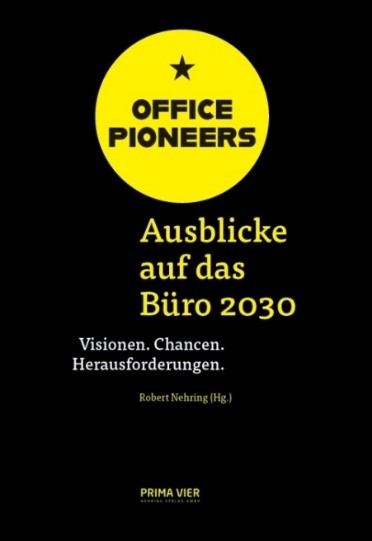Die Vorstellung klingt verlockend: Irgendwo in der Sonne sitzen, das Notebook auf dem Schoß, und das eigene Business läuft in einem Land mit niedriger Besteuerung und wenig Bürokratie. Doch was ist bei einer Unternehmensgründung im Ausland zu beachten? Ein Beitrag von Timm Schaffner.

Tatsächlich ist das Gründen im Ausland für deutsche Staatsbürger oft überraschend einfach. Abbildung: Matheus de Souza, Unsplash
Bevor der große Traum vom internationalen Unternehmertum beginnt, wartet ein Dschungel aus Regelungen, Steuerparagraphen und feinen Unterschieden zwischen „smart“ und „illegal“. Wer hier nicht genau hinsieht, verliert nicht nur Geld, sondern im schlimmsten Fall auch die Kontrolle über das eigene Unternehmen.
In welchen Ländern deutsche Staatsbürger gründen dürfen
Tatsächlich ist das Gründen im Ausland für deutsche Staatsbürger oft überraschend einfach. Zumindest auf dem Papier. Innerhalb der EU ist es fast schon banal: Die Niederlassungsfreiheit macht es möglich. Ob Estland, Spanien oder Polen. Der Weg zur eigenen Firma ist in vielen Fällen sogar digital begehbar. Sogar eine e-Residency, wie sie Estland anbietet, reicht aus, um eine Firma online zu registrieren. Ganz ohne physisch dort zu wohnen.
Außerhalb Europas sieht die Arbeitswelt etwas komplizierter aus. Zwar lassen sich in vielen Ländern Firmen auch ohne Wohnsitz gründen, doch nicht selten verlangen die Behörden zumindest eine ladungsfähige Adresse oder sogar einen lokalen Repräsentanten. Mal ist es ein verpflichtender Direktor vor Ort, mal eine Anlaufstelle für Steuer- und Rechtsfragen. Ohne das passende Setup geht’s selten wirklich los.
Kurz gesagt: Ein Wohnsitz im Gründungsland ist nicht zwingend notwendig, aber oft hilfreich. Oder schlicht erforderlich, wenn es um das Vertrauen von Banken, Kunden und Behörden geht.
Internationale Besonderheiten, branchenspezifische Hürden
Wer glaubt, dass die Gründung im Ausland für alle Branchen gleich funktioniert, unterschätzt die Vielfalt internationaler Regulierungen gewaltig. Besonders dann, wenn es ums liebe Geld, um Medizin oder um digitale Angebote geht.
Das wohl plakativste Beispiel ist das Glücksspiel. In Deutschland streng reguliert, in Ländern wie Malta oder Curacao hingegen vergleichsweise offen. Genau deshalb zieht es viele Anbieter dorthin. Die dortigen Lizenzen gelten als ausländisch reguliert und sicher. Sie ermöglichen einen rechtlich einwandfreien Betrieb, selbst wenn deutsche Behörden das Geschäftsmodell ablehnen oder mit Auflagen belegen würden.
Auch Finanzdienstleistungen, Nahrungsergänzung oder digitales Coaching stoßen in jedem Land auf andere Vorgaben. Was in Deutschland völlig legal ist, kann in Kanada lizenzpflichtig sein oder in Australien besondere Zertifizierungen erfordern. Hier entscheidet nicht nur das Produkt, sondern auch, wie es beworben wird, wo Server stehen und über welche Plattform verkauft wird. Für E-Commerce kann allein die lokale Mehrwertsteuer schon zum Stolperstein werden, wenn sie ignoriert wird.
Die Steuerpflicht in Deutschland
Ein weit verbreiteter Irrglaube: Nur weil die Firma irgendwo im Ausland sitzt, sind deutsche Steuerregeln plötzlich irrelevant. Die Realität sieht anders aus, ziemlich anders. Wer seinen Wohnsitz in Deutschland hat, bleibt voll steuerpflichtig. Und das betrifft nicht nur das private Einkommen, sondern auch die Unternehmensgewinne, die irgendwo zwischen Bali und Belize generiert wurden.
Entscheidend ist hier der Ort der Geschäftsleitung. Und der ist nicht etwa dort, wo das hübsche Büro bei Sonnenuntergang fotografiert wurde, sondern dort, wo die Entscheidungen fallen. Wer also täglich via Zoom vom Wohnzimmer in Köln aus bestimmt, was das Unternehmen tut, hat seine Geschäftsleitung in Deutschland. Egal, wo die Firma im Handelsregister steht. Fehlt der Nachweis, dass im Ausland wirklich ein funktionierender Betrieb läuft, kann das deutsche Finanzamt die Auslandsgesellschaft kurzerhand als inländisch einstufen. Dann wird’s nicht nur steuerlich ungemütlich, sondern schnell auch juristisch brenzlig.
Was sich von Deutschland deutlich unterscheidet
Wer schon mal versucht hat, in Deutschland eine GmbH zu gründen, weiß: Das dauert, kostet und macht keinen Spaß. Da locken Modelle wie die amerikanische LLC, die britische Ltd oder die polnische sp. z o.o. mit schnellerem Tempo, weniger Startkapital und weniger Papierkram.
Eine LLC in den USA kann innerhalb von 48 Stunden stehen. Die britische Ltd kostet oft weniger als ein Mittelklasse-Einkauf im Supermarkt. Und auch in osteuropäischen Ländern sind die Einstiegshürden überschaubar. Zumindest, wenn man weiß, was man tut.
Was viele unterschätzen: Nicht überall gibt es ein Handelsregister wie in Deutschland. In manchen Ländern läuft das Ganze über das Finanzamt oder spezielle Behörden. Auch die Anforderungen an Verträge, Übersetzungen und Beurkundungen können stark variieren. Gründungsagenturen helfen. Aber nicht alle sind seriös.
Schutz von Marke und Geschäftsidee sichern
Wer international tätig wird, muss seine Marke auch international denken. Eine Eintragung beim deutschen Patentamt reicht dann nicht mehr. Innerhalb der EU bietet die Unionsmarke Schutz in allen Mitgliedsstaaten. Ein echter Vorteil für alle, die europaweit arbeiten. Wer darüber hinaus will, landet beim Madrider System der WIPO. Damit lässt sich mit einem einzigen Antrag Markenschutz in mehreren Ländern sichern. Günstiger und schneller als Einzeleintragungen.
Ohne diesen Schutz besteht die Gefahr, dass sich Dritte den Namen sichern, sei es aus Kalkül oder schlicht schnellerer Reaktion. Gerade in Ländern mit niedrigen Schutzstandards kann das teuer werden. Entweder juristisch oder durch verlorenes Branding. Und: Marken müssen genutzt werden. Wer sie nur „vorsichtshalber“ eintragen lässt, ohne sie aktiv einzusetzen, riskiert Löschungsklagen. Frühzeitig handeln lohnt sich – nicht erst, wenn das Produkt durchstartet.