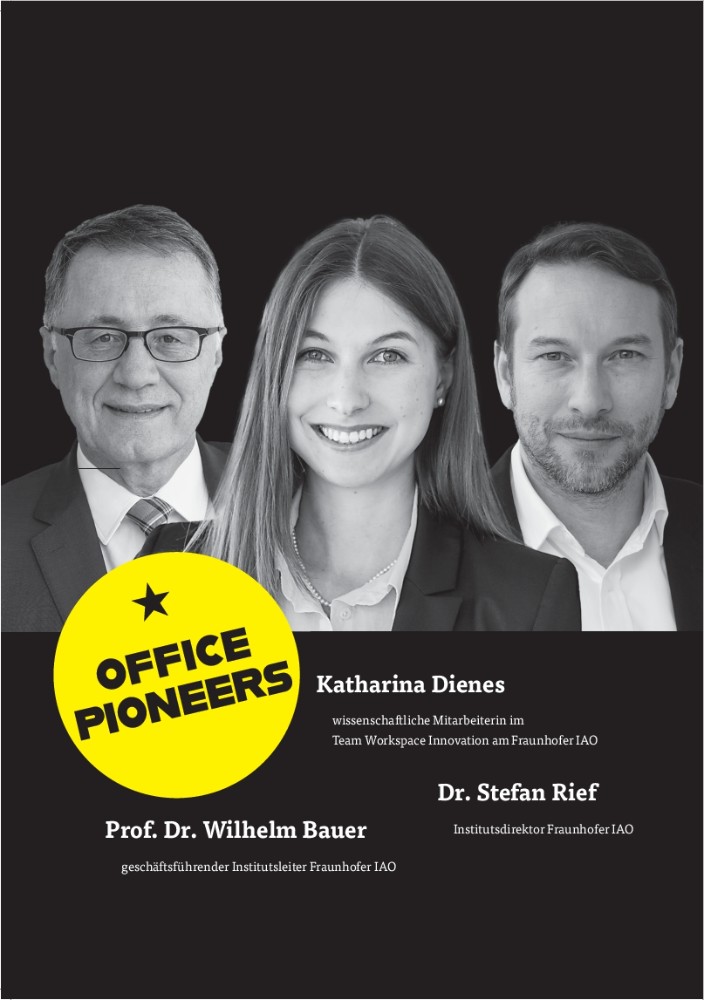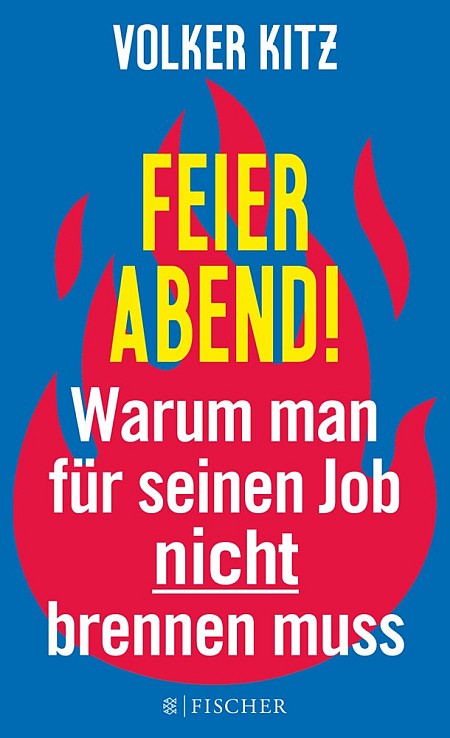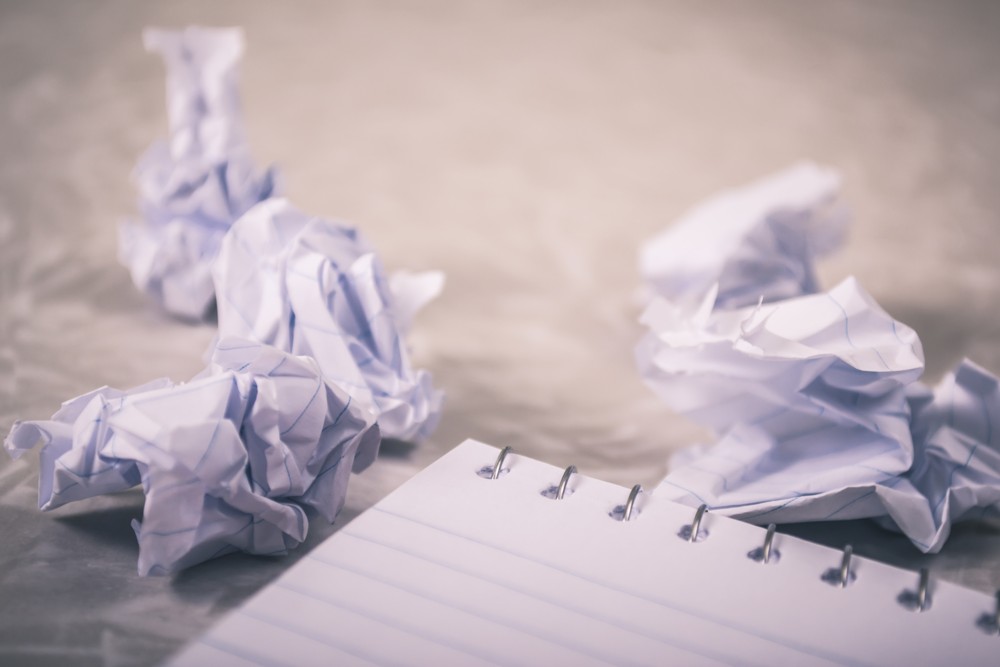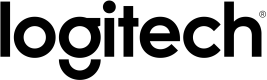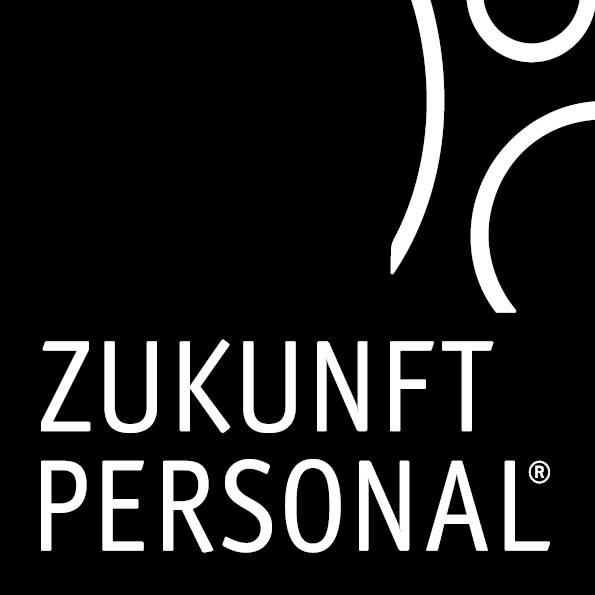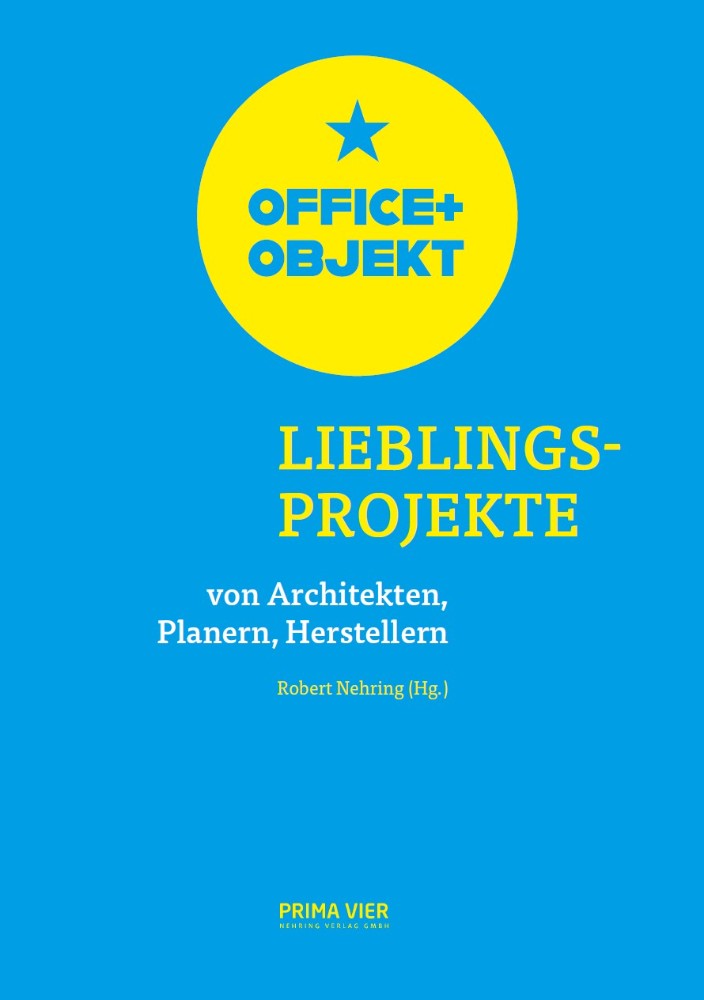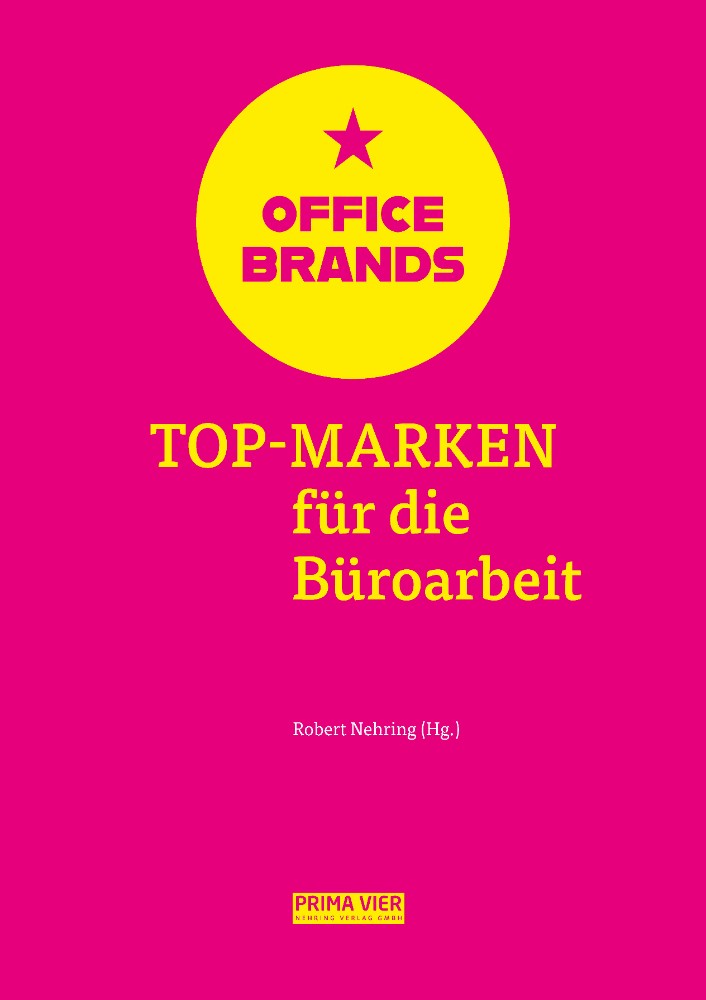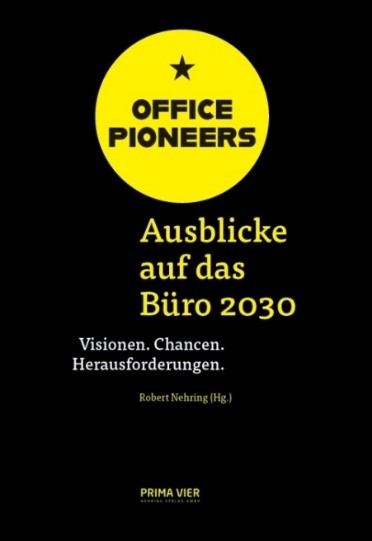Im zweiten Sammelband „OFFICE+OBJEKT. Lieblingsprojekte von Architekten, Planern, Herstellern“ werden weitere 44 Top-Projekte für Büro & Co. vorgestellt. Eingangs thematisieren renommierte Architekten die neuen Herausforderungen der modernen Büroarbeitswelt. Andrea Weitz und Prof. Jens Wendland von Raumkontor Innenarchitektur sind mit diesem Beitrag dabei.

Andrea Weitz, Prof. Jens Wendland, Innenarchitekten, Raumkontor Innenarchitektur. Abbildung: Sönke Peters Fotografie
Bevor wir einen Blick in die mögliche Zukunft des Arbeitens werfen, müssen wir uns einen Augenblick Zeit nehmen für einen gegenwartsdiagnostischen Schnappschuss. Da dieser per se nicht objektiv sein kann, setzen wir die persönliche Wahrnehmung vieler an den Anfang: Ein Großteil der Menschen schaut aktuellen Umfragen zufolge mit Sorge in die Zukunft. Die Zukunft ist also nicht mehr das große Versprechen (das war eine die Moderne durchziehende Erzählung), sondern ein Risikoszenario auf allen nur denkbaren Ebenen: politisch und sozial, technologisch und wirtschaftlich, mit Blick auf die Umwelt genauso wie in Hinblick auf persönliche Perspektiven.
Es hat sich etwas geändert seit den 70er- und 80er-Jahren, in denen Frithjof Bergmann seine optimistischen Perspektiven einer neuen Gesellschaft entwickelte. Er hatte eine revolutionäre Vision des Zusammenlebens, selbstbestimmt und erfüllend – also übereinstimmend mit den Wünschen und Hoffnungen jedes Einzelnen. Daraus entwickelte er sein New-Work-Szenario eines völlig anderen Arbeitens und Miteinanderlebens, in dem Konsum und Verbrauch auf das Notwendige zurückgeschraubt werden und sich (auch dadurch) das Selbst entfaltet. Diesem Ideal sind wir gesellschaftlich kaum näher gekommen. Was geblieben ist, ist der Begriff „New Work“ – und die damit verbundenen Klischeebilder der fröhlich bunten, offenen Arbeitswelten mit Kicker und Apfelschnitzen.
Diese Anmerkung ist aber keineswegs kulturpessimistisch und erst recht nicht resignativ zu verstehen. Sie zeigt nur auf, dass sich in der Folge der Aufbruchs- und Selbstentwicklungseuphorie des letzten Jahrhunderts ein zu enges Bild der Arbeitswelten und -orte entwickelt hat, das unserer Lebenswirklichkeit nicht mehr entspricht und dessen Leerstellen zu füllen sind. Gleichzeitig sind dessen erreichte Qualitäten dabei nicht über Bord zu werfen, das wäre regelrecht tragisch. Denn es geht ja nicht um ein nostalgisches Zurück in verbrämte Vergangenheiten, die es so ohnehin nie gegeben hat, sondern um ein Anreichern, um ein Eröffnen neuer Möglichkeitsräume. Insofern doch wieder Frithjof Bergmann: „Was wir im Sinn hatten, war verknüpft mit den Begriffen von Improvisation, Erfindung, Innovation.“

Bei allen Projekten steht die Kreislauffähigkeit der verwendeten Materialien im Mittelpunkt. Abbildung: Jens Wendland
Partizipation und Identifikation
Hier greift unser erstes Credo: Die Mitarbeitenden ganz früh einzubinden ist ungeheuer wertvoll. Ihre Bedürfnisse auszuloten und die Impulse aus den Teams in die Planung zu integrieren bringt oft völlig neue Aspekte in ein Projekt. Wir meinen echte Teilhabe, die ernsthaft ergebnisoffen ist und die Menschen da erreicht und abholt, wo sie stehen. Es geht eben nicht darum, den Mitarbeitenden die allerorts kursierenden Klischeebilder von „New Work“ aufzupfropfen, sondern sie ernst zu nehmen. Gemeinsame Workshops helfen dabei, strukturelle Zusammenhänge herauszuarbeiten, gruppendynamisch-psychologische Befindlichkeiten auszuloten und sich gestalterisch-atmosphärischen Werten anzunähern. Gemeinsam eine Struktur zu entwickeln, die das Individuelle mit dem sachlich gebotenen Allgemeinen vernetzt, ist der Schlüssel für eine lebbare Gestaltung.
Wenn unterschiedliche Lebenswelten (Arbeiten und Privates, Lernen und Freizeit ...) sich vernetzen und überlagern, hat das zur Folge, dass auch das Büro mit gestalterischen Mitteln Identifikationspotenzial bieten muss. Als ‚Home-away-from-home‘ dürfen neue Arbeitswelten daher mit Persönlichkeit aufgeladen sein. Vielfältigkeit ist eine Qualität des Privaten. Deshalb ist Liebe zum Detail notwendig, gern auch mit der individuell-skurrilen Interpretationsvielfalt, die den Menschen ausmacht. Strukturell ist Angebotsvielfalt wunderbar (auch zu Hause sitzen wir mit dem Laptop am Küchentisch, auf dem Sofa oder auf dem Balkon). Verbindende Gestaltungsfäden sind wichtig, Varianz (konzeptionell und atmosphärisch) aber unabdingbar. Und besonders: Ich identifiziere mich erst mit einem Ort, wenn ich Spuren hinterlassen darf. Die Gestaltung der Planer ist nur die Hintergrundfolie für die Persönlichkeit jedes einzelnen Mitarbeitenden.
Für uns rückt ein anderer Aspekt immer stärker in den Fokus: die Idee eines beständigen, mit Sorgfalt konzipierten und hergestellten Designs, in dem die Natürlichkeit der Materialien sinnlich und körperlich spürbar ist. Uns sind die Nuancen wichtig, die eine wohlabgestimmte Atmosphäre ausmachen. Wir lieben die Vielschichtigkeit und Komplexität des Miteinanders unterschiedlichster Materialien mit ihren Oberflächen und Strukturen. Dazu kommt das Ausloten neuer Materialitäten, die Lust am Experiment und am Erfinden eigener Produkte. Man darf alles tastend erleben, man genießt es, dass Architektur spürbar wird.
Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit
Es liegt an uns, die Themen Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit in den Mittelpunkt unseres Handelns zu rücken. Immer mehr Bauherren öffnen sich für diese Ideen, ihnen können wir nicht die Verantwortung für fehlendes Nachhaltigkeitsengagement in die Schuhe schieben. Verantwortungsbewusstes Handeln im Sinne Kreislaufwirtschaft und gutes Design können Hand in Hand gehen. Aber das erfordert ein ernsthaftes Auseinandersetzen mit den oft komplexen Verflechtungen der Produktions- und Lieferketten und eine Lust an der Eroberung neuer Material- und Produktkontinente. Oft bringen das frühe Nachdenken über die Möglichkeiten einer zirkulären Wertschöpfung und die damit verbundenen Sondierungen eine beruhigende Klarheit in den Entwurf.
Wir brauchen Planer, die Themen neu umkreisen, ihnen ungewöhnliche Facetten abringen, in denen vertraute Welten und irritierende Momente verschmelzen.“
Andrea Weitz & Prof. Prof. Jens Wendland,
Raumkontor Innenarchitektur.
Kreislauffähigkeit bringt ein neues Denken über den Bestand mit sich – auf allen architektonischen und innenarchitektonischen Ebenen. Dabei wird schnell deutlich: Vertraute Schemata der Einheitlichkeit, der Durchgängigkeit und der Perfektion sind zu hinterfragen. Vielleicht treten die Prinzipien der Collage und des Samplings in den Vordergrund, vielleicht die freche Assemblage von Neuem und Altem, die Verfremdung oder das Experiment vor Ort. Nicht umsonst liegt hier das Vokabular der Kunst nahe als Indiz für Aufbruchswillen und -notwendigkeit. So verschieben sich auch die Erwartungsparameter für die Vorhersehbarkeit des Resultats: Für diese Prozesshaftigkeiten gilt es zu begeistern und ein Verständnis zu schaffen.
Nostalgie ist ein Teil der Gegenwartskultur. Doch der Blick zurück ist seit jeher das No-Go „guter“ und „moderner“ Gestaltung – und zugleich eine nicht wegzudiskutierende Sehnsucht der Nutzer. Diese Nutzerperspektive wurde oft ignoriert, was zu Überforderungen und Distanz führt. Dabei gibt es so viele Möglichkeiten, der Faszination für Zurückliegendes (mit den damit verbundenen Projektionen) und dem Wunsch nach dem Bewahren alter Kultur- und Gestaltungsqualitäten Raum zu geben, egal, ob in direkter Einbindung oder in Prozessen der Transformation. Das Nicht-Jetztzeitige bekommt plötzlich etwas Gegenwärtiges – ästhetisch und emotional.
Neue Formen des Miteinanders
Arbeiten heißt, immer wieder neue Formen des Miteinanders zu praktizieren, um sich gegenseitig zu unterstützen und zu motivieren. Das braucht entsprechende Voraussetzungen in der Unternehmens- und Führungskultur, aber genauso auch räumliche und gestalterische Motivationsmomente. Vielleicht ist es der große Kochblock, um den herum debattiert, geschnipselt, gebraten, gelacht und um neue Konzeptbausteine gerungen wird. Hier darf es schmoren und heiß hergehen – um sich dann im nebenliegenden Speiseraum an der großen Tafel zusammenzufinden. Oder es sind Räumlichkeiten, um einer gemeinsamen Leidenschaft nachzugehen, wie Bier zu brauen oder Musik zu machen.

Es gibt keine Einheitslösungen: Der Fokus der Gestaltung liegt immer auf individuellen Ansätzen. Abbildung: bullahuth Fotografie und Gestaltung
Mehr „wir“ bringt, da sind sich alle arbeitspsychologischen Untersuchungen einig, mehr Freude und Energie und damit einhergehend wie von selbst mehr Produktivität. Mehr „wir“ stärkt die Identifikation mit dem Unternehmen und lässt den Einzelnen aufleben.
Das, was der Idee eines kommunikativen und kreativen Miteinanders häufig entgegensteht, sind die erheblichen Anteile repetitiver Arbeitsabläufe. Das in sich versunkene Abarbeiten prägt viele Arbeitstage, ein Miteinander wird eher als Störung denn als Bereicherung erlebt. Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, dass solche Arbeitsprozesse KI-unterstützt abschmelzen. Vorausschauend agierende Firmen werden frei werdende Potenziale nicht verlieren wollen, sondern zur Weiterentwicklung ihrer Unternehmen nutzbar machen. Das birgt ein noch nicht absehbares Potenzial für neue Arbeitsformen und -prozesse.
Individuelle Ansätze
Wenn wir von Innenarchitektur reden, meinen wir mit großer Selbstverständlichkeit ein sehr spezifisches Eingehen auf den Kunden mit seinen Unternehmenswerten und zugleich ein Reflektieren des Ortes – womit natürlich das Gebäude gemeint ist, genauso aber die regionale Einbindung und damit die Bezugnahme auf die Unternehmenstradition. Beide Aspekte, verbunden mit einer aus der individuellen Unternehmenssituation erwachsenden Idee von zukunftsfähigen Arbeitswelten, ergeben ein individuelles Raumkonzept mit einem ganz eigenen Gesicht. Nicht immer sind die stereotyp eingesetzten New-Work-Ingredienzen die richtige Antwort. Das genaue Austarieren von Offenheit und Separation, somit zwischen Kommunikation und Ruhe, kann unternehmensspezifisch auch Schwerpunkte mit intimen, geschlossenen Arbeitssituationen sinnvoll machen.
Wir brauchen Planer, die Themen neu umkreisen, ihnen ungewöhnliche Facetten abringen, in denen vertraute Welten und irritierende Momente verschmelzen. Und wir brauchen Unternehmen, denen bewusst wird, dass wir in einer Schwellenzeit leben, in der die alten Trampelpfade obsolet geworden sind, in der man etwas wagen muss. Sind wir jetzt verrückt geworden, spleenig, verträumt? Nein, wir sind Profis und planen seit dreißig Jahren Büros. Und sagen gerade deswegen und gerade jetzt: auf ins Offene!
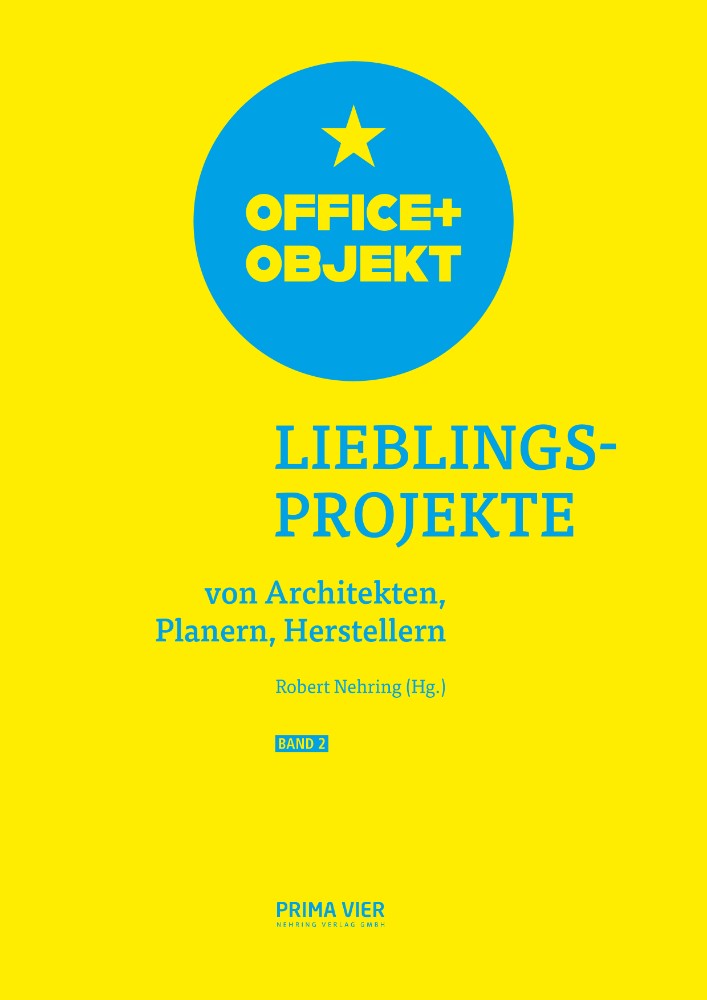
BUCHTIPP: OFFICE+OBJEKT. Lieblingsprojekte von Architekten, Planern, Herstellern. Band 2Im zweiten Sammelband „OFFICE+OBJEKT“ werden weitere 44 Top-Projekte für Büro & Co. vorgestellt. Es handelt sich um besonders gelungene Planungs- und Einrichtungsbeispiele, „Lieblingsprojekte“ namhafter Architekten, Planer und Hersteller. Auch dieser im Berliner PRIMA VIER Nehring Verlag erschienene Sammelband hat 208 hochwertig produzierte Seiten. Nach den Autorenbeiträgen renommierter Architekten folgen die bilderreich dargestellten Referenzbeiträge: Top-Projekte, die den Architekten, Planern und Herstellern besonders am Herzen liegen und die Redaktion beeindruckt haben. Zusammen mit Band eins liegen nun 88 Leuchtturm-Projekte vor, bilderreich dokumentiert auf 416 Seiten – zwei Werke voll mit Impulsen und Inspirationen für neue Räume in Büroumgebungen. „OFFICE+OBJEKT. Lieblingsprojekte von Architekten, Planern, Herstellern“, Band 2, Robert Nehring (Hg.), PRIMA VIER Nehring Verlag, Berlin 2025, 208 Seiten, DIN A4, 79,90 € (Hardcover), 64,90 € (E-Book). Erhältlich unter office-roxx.de/shop. |