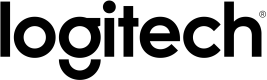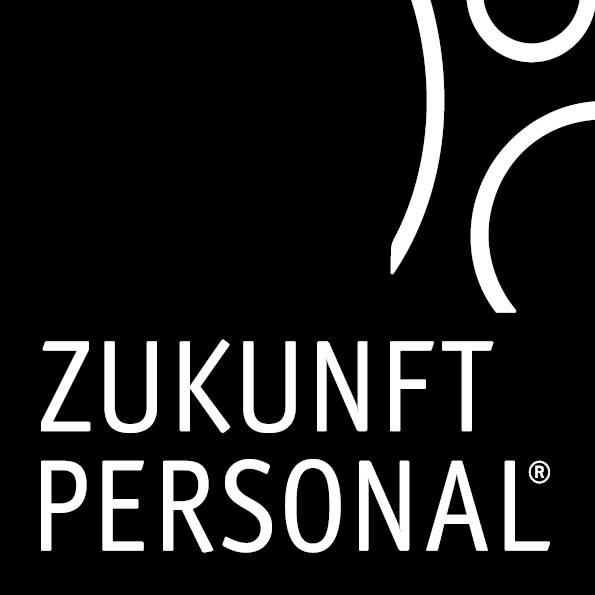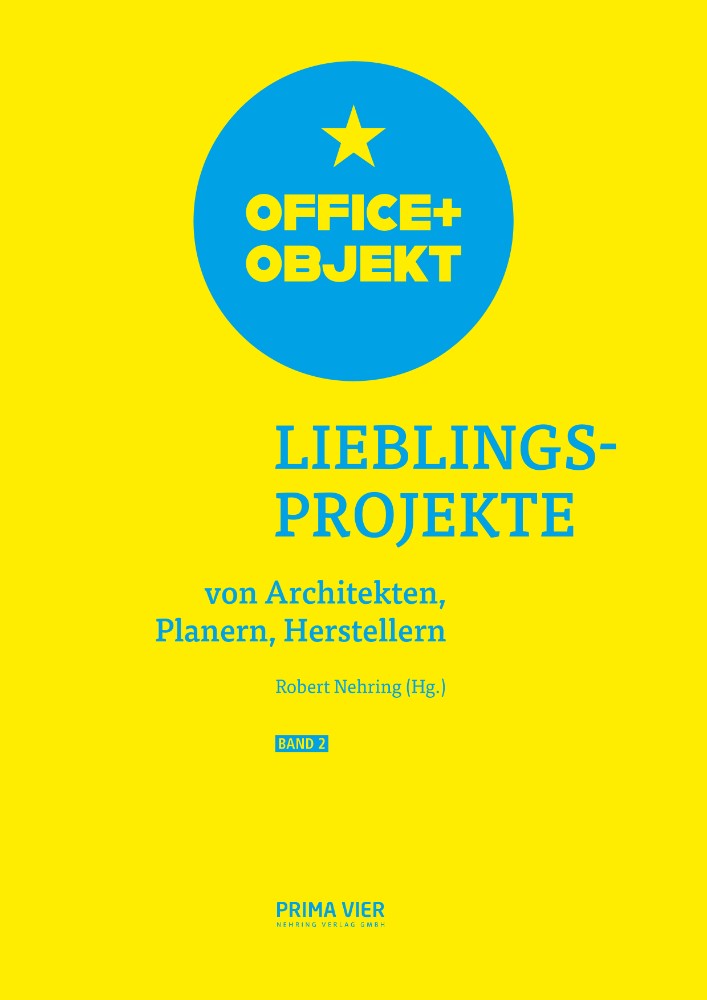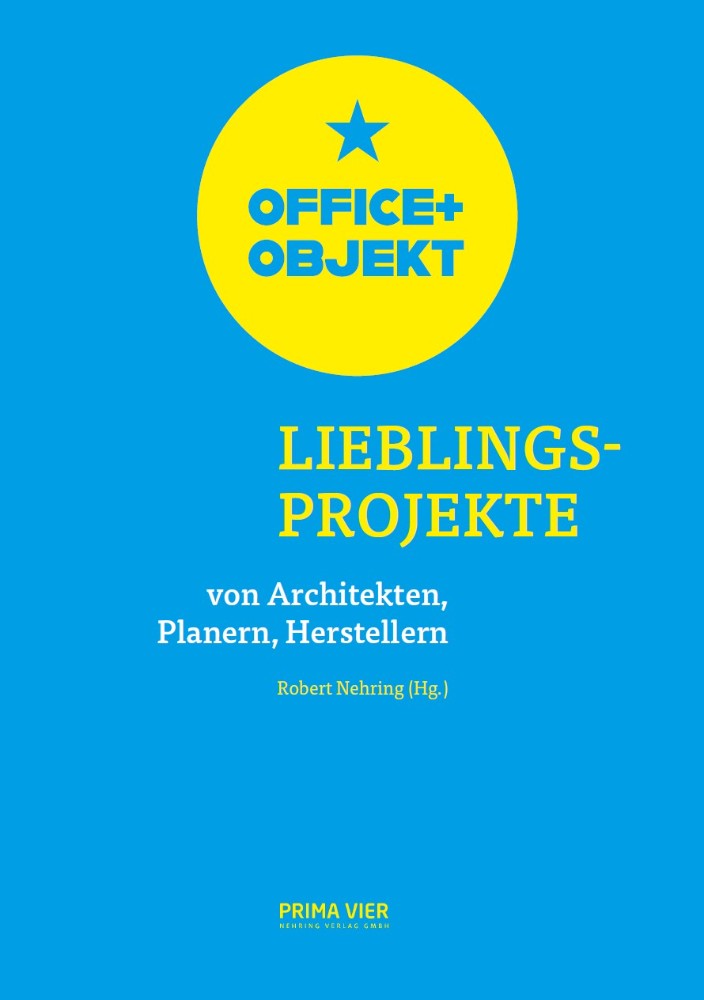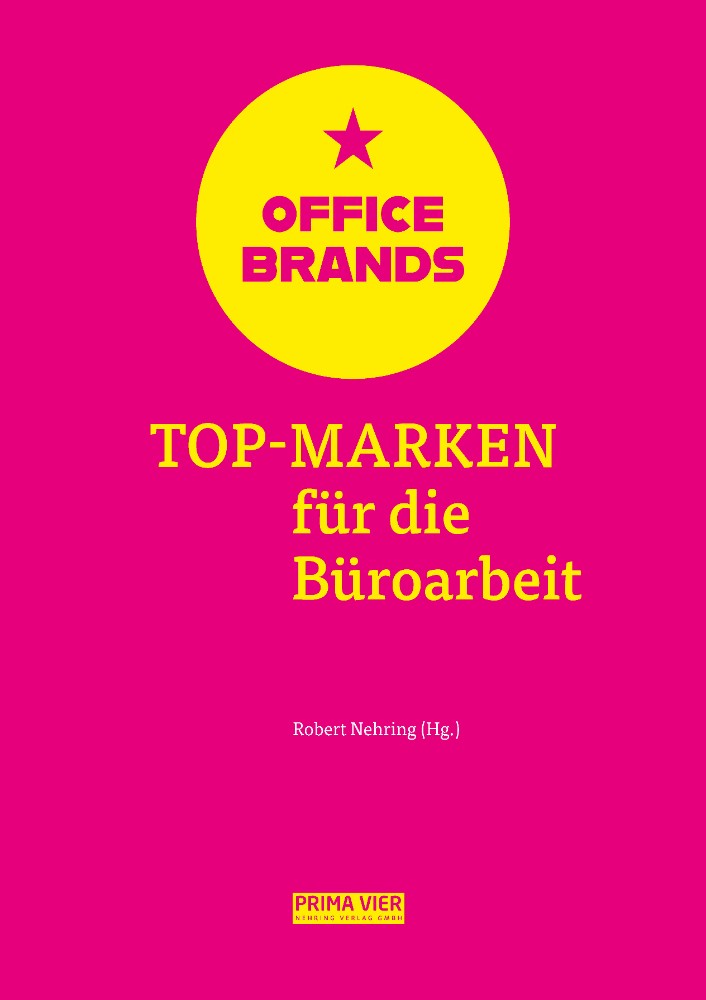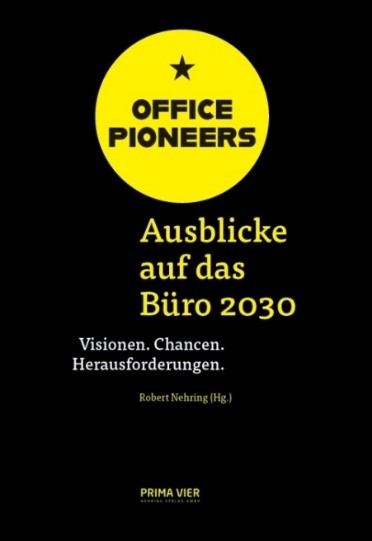Forscher der Universität Tokio haben sich mit dem Thema Prokrastination auseinandergesetzt. Sie stellten fest: Der Blick auf die Zukunft ist entscheidend.

„Das wird nichts mehr“ – Prokrastinierer blicken möglicherweise pessimistischer in die Zukunft. Abbildung: Resume Genius, Unsplash
Prokrastination – das Aufschieben einer Aufgabe, selbst wenn man weiß, dass dies negative Folgen haben wird – ist ein Verhalten, das mit Stress und geringerem Wohlbefinden einhergeht. Saya Kashiwakura und Kazuo Hiraki von der Universität Tokio untersuchten, wie Prokrastinierer Stress und Wohlbefinden zu verschiedenen Zeitpunkten wahrnehmen. Sie haben die Ergebnisse ihrer Untersuchung in einer Studie veröffentlicht.
Von leicht bis schwer
„Ich sage mir ständig: Das mache ich morgen.“ oder „Ich ertappe mich oft dabei, dass ich Aufgaben erledige, die ich eigentlich schon Tage vorher erledigen wollte.“ Anhand ihrer Zustimmung zu Aussagen wie diesen teilten die Forscher die rund 300 Teilnehmenden zunächst in schwere, mittlere und leichte Prokrastinierer ein. Anschließend wurden die Teilnehmenden gebeten einzuschätzen, wie gestresst oder glücklich sie sich zu bestimmten Zeitpunkten der Vergangenheit und Zukunft fühlten bzw. fühlen werden. Etwa in den letzten zehn Jahren, im letzten Jahr, gestern, heute, morgen und in den kommenden zehn Jahren. Ziel war es, den Zusammenhang dieser zeitlichen Wahrnehmungen mit dem Prokrastinationsverhalten zu erfassen und in Relation zu setzen.
Neue Erkenntnisse
Die Studie bestätigt frühere Untersuchungen darin, dass Prokrastinierer gestresster und weniger glücklich sind als Menschen, die nicht prokrastinieren. Sie zeigt außerdem, dass dies insbesondere auf starke Prokrastinierer zutrifft. Die Forscher entdeckten darüber hinaus, dass Menschen mit optimistischen Zukunftsvorstellungen mit geringerer Wahrscheinlichkeit schwere Prokrastinierer sind. Interessanterweise fanden die Forscher keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Prokrastination und negativen Ansichten über das persönliche Wohlbefinden oder die Lebensziele. Entscheidend war die Hoffnung, dass es ihnen in der Zukunft besser gehen würde.
Was ist Prokrastination?
Laut der Prokrastinationsambulanz der Universität Münster ist Prokrastination die wissenschaftliche Bezeichnung für pathologisches Aufschiebeverhalten. Prokrastination ist eine ernst zu nehmende Arbeitsstörung und kann sowohl private Alltagsaktivitäten als auch schulische, akademische und berufliche Tätigkeiten betreffen. Prokrastination kann als Teil einer diagnostizierbaren psychischen Störung, wie einer Depression, einer Angststörung oder der Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitätsstörung (ADHS), auftreten. Allerdings beeinträchtigt sie auch das psychische Wohlbefinden und kann so selbst zur Ursache für andere psychische Belastungen und Symptome werden.